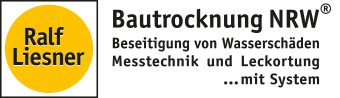Feuchtigkeit in Decken, Wänden oder Estrich? Ein Wasserschaden ist immer ärgerlich und verursacht Kosten. Dazu kommt, dass die Schadensquelle nicht immer direkt ersichtlich ist. So kann z.B. schon ein kleines Leck in einer Rohrleitung, aus dem Wasser austritt, enorme Schäden verursachen. Um diese zu verhindern bzw. zu minimieren, sollte das Leck daher so schnell wie möglich gefunden werden. Glücklicherweise gibt es hierzu professionelle Hilfsmittel und Methoden, die zur Leckortung eingesetzt werden und die in vielen Fällen die Ursache für die Feuchtigkeit schnell und zerstörungsfrei ausfindig machen. In unserem Beitrag erfahren Sie, wann eine Leckortung durchgeführt wird, wo Lecks häufig entstehen und wie eine Leckortung abläuft.
Wann ist eine Leckortung notwendig?
Sie haben einen Wasserschaden und haben die Schadensursache direkt ausfindig machen können? Dann haben Sie Glück im Unglücksfall! Wenn die Schadensursache eindeutig ist, ist auch eine Leckortung nicht notwendig. Allerdings ist es in vielerlei Fällen eher so, dass die Lecks versteckt auftreten und mit bloßem Auge nicht lokalisiert werden können. Dieses ist z.B. bei Rohren der Fall, die in der Wand verlaufen. Das Identifizieren des Schadens ist aber wichtig, da weitere Maßnahmen erst nach Feststellung der Undichtigkeit möglich sind.
Wo treten häufig Leckagen auf und warum?
Man unterscheidet grundlegend zwischen drei Arten von Leckagen. Es gibt Leckagen, die das Heizsystem betreffen, Leckagen, die das Leistungswassersystem betreffen und Leckagen, die das Gebäude direkt wie z.B. Dach, Fassade oder Fundament umfassen.
1. Lecks im Heizungssystem
Eine von außen deutlich erkennbare Austrittsstelle ist bei einem Leck im Heizungssystem oft nicht identifizierbar. Häufig tritt das Leck z.B. nicht direkt am Heizkessel oder an einem Sicherheitsventil auf, sondern direkt an den Heizungsrohren. Das Manometer in der Heizungsanlage kann bei einem Druckabfall auf ein Leck hindeuten. Um das Leck dann schließlich örtlich ausfindig zu machen, wird in der Regel eine Wärmebildkamera eingesetzt.
2. Lecks im Leitungswassersystem
Gerade Wasserleitungen sind relativ häufig von Leckagen betroffen. Die Gründe für diese Lecks sind vielfältig. Falsche Installationen, Herstellungsfehler, nachgebendes Material durch Rost, Materialermüdung oder Frost sind nur einige Ursachen, die man hier nennen kann.
3. Lecks direkt am Gebäude
Undichte Stellen können z.B. auch durch Schäden am Dach oder der Fassade auftreten, sodass Regenwasser eindringen kann. Auch das Fundament kann betroffen sein. Bei Dächern sind insbesondere Flachdächer häufig aufgrund Ihrer Konstruktion von Undichtigkeiten betroffen (für weitere Informationen schauen Sie sich gerne unseren Blogbeitrag zum Thema an: https://www.bautrocknung-nrw.de/2022/07/wasserschaden-flachdacher/)
Welche Verfahren zur Leckortung gibt es?
Durch den systematischen Einsatz modernster Detektionsverfahren können Messtechniker die verborgenen Leckstellen und Rohrbrüche schnell und sicher orten. Dabei gibt es ein großes Spektrum an fachgerechten Diagnoseverfahren zur Leckortung und Feuchtigkeitsuntersuchung. Häufig werden diese Ortungsverfahren auch kombiniert eingesetzt. Diese sind in den meisten Fällen glücklicherweise zerstörungsfrei oder zumindest zerstörungsarm. Zu den Verfahren gehören u.a. die Feuchtigkeitsmessung mit einem Feuchtigkeitsmessgerät, der Einsatz von Wärmebildkameras, die akustische Leckortung, bei der die veränderten Schallwellen, die bei Leckagen auftreten, gemessen werden als auch die Videoendoskopie, bei der ein Videoendoskop in die Leitungen eingeführt wird. Weitere Methoden, die bei der Leckortung üblich sind, sind die Tracergasmethode, bei der der Gasaustritt gemessen wird, um Lecks zu identifizieren oder auch das Befüllen der Leitungen mit Druckluft zur Feststellung des Druckverlustes. Darüber hinaus gibt es noch einige weitere Prüfmethoden. Gerade bei der Ortung von Wasserrohrbrüchen verlangt jede Problemstellung andere Prüftechniken und jeder Schaden eine auf die jeweilige Situation angepasste Vorgehensweise.
Wir sind die Leckortungs- und Messtechnikspezialisten
Bei uns sind Sie genau richtig, wenn es darum geht, einen Wasserschaden zu lokalisieren. Hier verfügen wir über einen Erfahrungsschatz von mehr als 26 Jahren. Durch den systematischen Einsatz modernster Detektionsverfahren können Messtechniker die verborgenen Leckstellen und Rohrbrüche schnell und zerstörungsarm orten. Ein weiterer Vorteil für Sie: Bei uns erhalten Sie die Leckortung zum Festpreis. Dieser enthält neben der An- und Abfahrt sowie der Bereitstellung des benötigten Messequipments auch einen ausführlichen Schadensfeststellungsbericht mit Text- und Bildprotokoll.
Alternativ können Sie bei uns Messinstrumente zur Leckortung mieten. Eine Übersicht über unser Angebot an Messtechnik erhalten Sie hier:
https://www.bautrocknung-nrw.de/produkt-kategorie/vermietung/messtechnik/